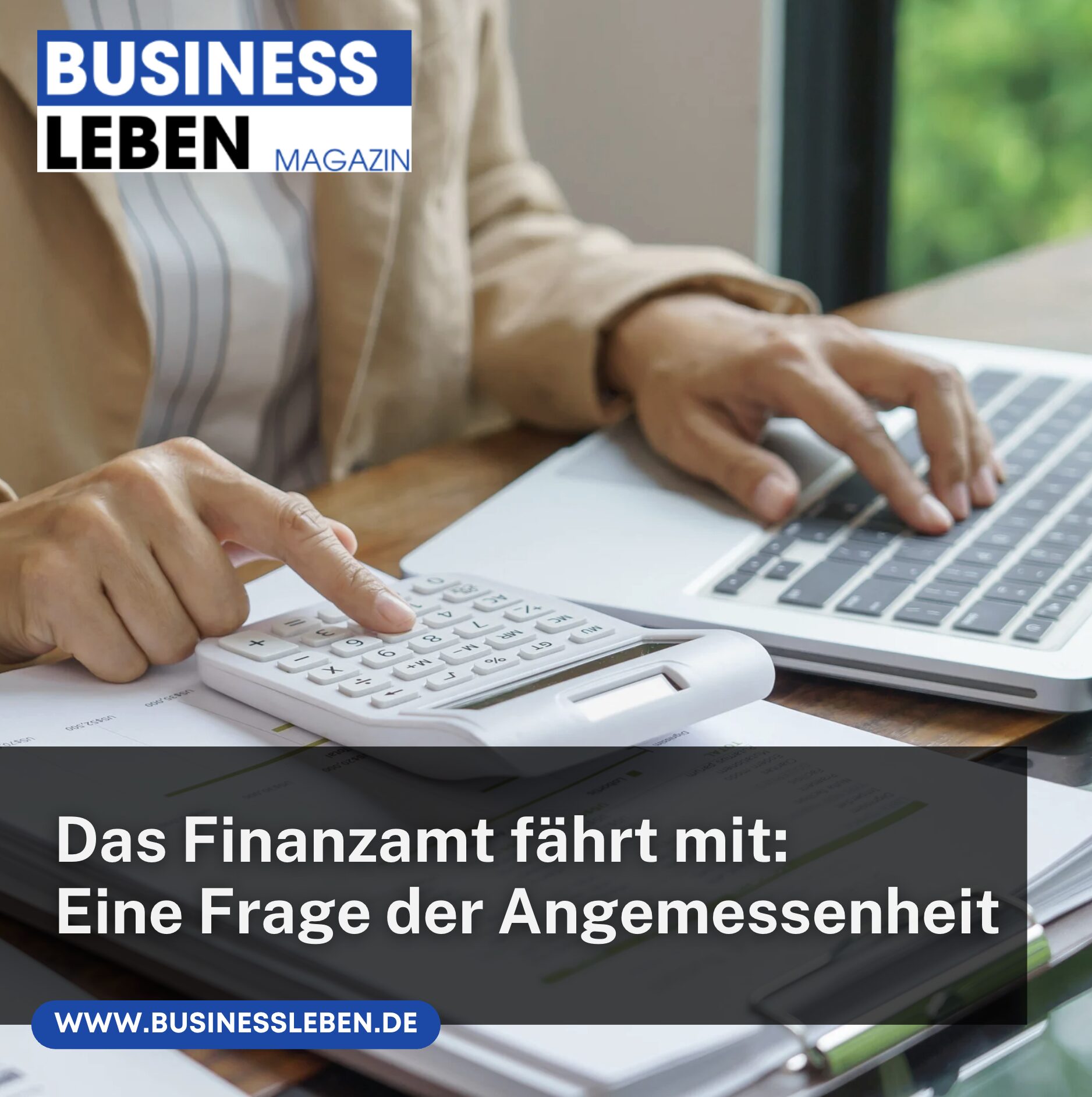Die Vorstellung ist verlockend: Mit dem Brüllen eines Zwölfzylinders zum Geschäftstermin vorfahren und die Kosten für den italienischen Sportwagen auch noch von der Steuer absetzen. Ein Ferrari als Firmenwagen ist für viele der Inbegriff unternehmerischen Erfolgs. Doch bevor man sich diesem Traum hingibt, sollte man die steuerlichen Realitäten und die strengen Augen der Finanzbehörden kennen. Der Weg zum legalen Steuersparmodell mit einem Luxusfahrzeug ist schmal, steinig und mit zahlreichen Fallstricken gepflastert. Es ist weniger eine Frage, ob es grundsätzlich geht, sondern vielmehr, unter welchen extrem engen Voraussetzungen die Behörden mitspielen. Wer hier nicht akribisch plant, erlebt bei der nächsten Betriebsprüfung ein teures Erwachen.
Die erste Hürde: Exorbitante Kosten bei der Versicherung
Noch bevor das Finanzamt überhaupt ins Spiel kommt, wartet eine erhebliche finanzielle Hürde: die Versicherung. Wer glaubt, einen Ferrari wie einen gewöhnlichen Passat versichern zu können, irrt gewaltig. Standardtarife mit Schadenfreiheitsklassen gibt es für solche Fahrzeuge in der Regel nicht. Versicherer kalkulieren hier mit festen Jahresprämien, die das hohe Risiko widerspiegeln. Eine Vollkaskoversicherung kann schnell einen fünfstelligen Betrag pro Jahr erreichen. Üblich sind zudem hohe Selbstbeteiligungen, die oft bei 5.000 oder 10.000 Euro liegen.
Die Versicherer prüfen außerdem sehr genau, wer ans Steuer darf. Fahrer unter 30 Jahren haben kaum eine Chance auf Versicherungsschutz und es werden oft Nachweise über Erfahrung mit leistungsstarken Fahrzeugen verlangt. Diese laufenden Kosten müssen von Anfang an in die Kalkulation einfließen und schmälern die erhoffte Steuerersparnis bereits erheblich, noch bevor der erste Kilometer betrieblich gefahren wurde. Tipp: Unter Ferrari KFZ Versicherung Tarife vergleichen, um den günstigsten zu finden.
Das Finanzamt fährt mit: Eine Frage der Angemessenheit
Ist die Hürde der Versicherung genommen, beginnt der eigentliche Spießrutenlauf mit dem Finanzamt. Zwar gibt es im deutschen Steuerrecht keine offizielle Obergrenze für den Preis eines Firmenwagens. Theoretisch kann also auch ein Auto für 250.000 Euro als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. In der Praxis prüfen die Beamten jedoch jeden Einzelfall auf die sogenannte Angemessenheit. Die entscheidende Frage lautet: Sind die Kosten für das Fahrzeug im Verhältnis zur Größe, zum Umsatz und vor allem zum Gewinn des Unternehmens vertretbar?
Ein IT-Berater mit einem Jahresgewinn von 80.000 Euro wird kaum argumentieren können, warum er einen Ferrari für Kundengespräche benötigt. Ein international tätiger Architekt mit Millionenumsätzen, der ausschließlich im Luxussegment arbeitet, hat hier potenziell bessere Karten. Der Repräsentationszweck muss klar ersichtlich und für den Geschäftserfolg von Bedeutung sein.
Ohne lückenlose Beweise keine Anerkennung
Die Beweislast, dass der teure Sportwagen betrieblich notwendig ist, liegt vollständig beim Unternehmer. Das Finanzamt geht bei einem Fahrzeug dieser Kategorie grundsätzlich von einer intensiven privaten Nutzung aus. Um diesen Anscheinsbeweis zu widerlegen, ist ein Fahrtenbuch das A und O. Und zwar ein absolut lückenloses und unangreifbares. Jede einzelne Fahrt muss mit Datum, Kilometerstand, Reiseroute, Zweck und Geschäftspartner dokumentiert werden.
Kleinste Fehler oder Ungereimtheiten können dazu führen, dass das gesamte Fahrtenbuch verworfen wird. Die Alternative, die pauschale Ein-Prozent-Regelung, ist bei einem so hohen Bruttolistenpreis meist finanziell unattraktiv, da der zu versteuernde geldwerte Vorteil enorm hoch ausfällt. Wer den Aufwand eines perfekten Fahrtenbuchs scheut, hat im Grunde schon verloren.
Wenn der rote Renner zum roten Tuch wird
Stuft das Finanzamt die Kosten als unangemessen ein, werden die Betriebsausgaben gekürzt. Das bedeutet, dass nur ein Teil der Abschreibungen und der laufenden Kosten gewinnmindernd anerkannt wird. Der Rest wird dem Gewinn wieder hinzugerechnet und muss nachversteuert werden. Die Behörden orientieren sich dabei oft an den Kosten, die für ein Fahrzeug der Oberklasse, beispielsweise eine S-Klasse von Mercedes, als angemessen gelten würden.
Die Differenz zahlt der Unternehmer aus eigener Tasche, zuzüglich Zinsen. Aus dem Traum vom steuerlich geförderten Ferrari wird so schnell ein finanzieller Albtraum, der die Freude am Fahren empfindlich trübt. Es bleibt festzuhalten: Die Anerkennung eines Luxussportwagens als Firmenwagen ist und bleibt eine seltene Ausnahme, die nur mit einer wasserdichten Argumentation und für ein passendes Unternehmensprofil überhaupt denkbar ist.