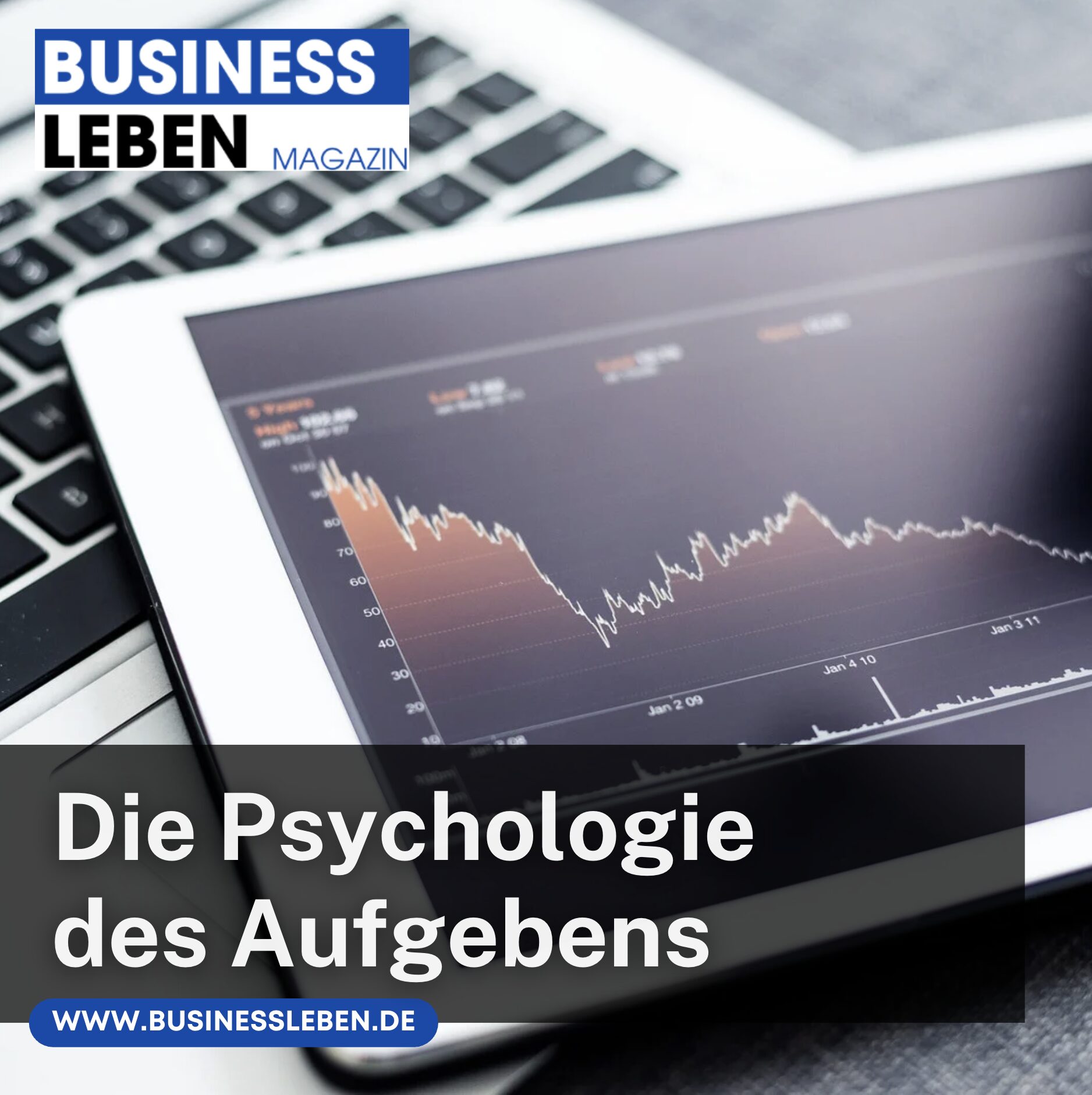Eine neue Studie der KfW offenbart etwas Unerwartetes: Eine wachsende Zahl von mittelständischen Unternehmen entscheidet sich bewusst gegen Bankkredite. Der Rückgang von 40 Prozent im Jahr 2004 auf nur noch 23 Prozent im Jahr 2023 ist fast eine Halbierung. Und das, obwohl die Zinssätze über einen langen Zeitraum extrem niedrig waren. 27 Prozent der KMU geben mittlerweile an: Wir wollen grundsätzlich auf Fremdfinanzierung verzichten.
Was ist der Hintergrund? Und was tun diese Firmen stattdessen?
Die Psychologie des Aufgebens
Es gibt zahlreiche Ursachen für die Skepsis gegenüber Krediten. Eine Menge Unternehmer möchten einfach keine Schulden haben. 36 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) nennen das als Hauptgrund. Oft steckt der Wunsch nach Unabhängigkeit dahinter: Wer keine Kredite hat, muss auch niemandem Rechenschaft ablegen.
Andere verfügen über ausreichend Eigenmittel. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Eigenkapitalquote im Mittelstand einen bemerkenswerten Anstieg erlebt: Sie ist von 18 auf über 30 Prozent geklettert. Das ist positiv für die Stabilität, aber es bedeutet auch: Weniger Firmen sind auf Fremdkapital angewiesen.
Und dann ist da noch die Bürokratie. Übermäßige Offenlegungspflichten, überzogene Sicherheitenanforderungen, langwieriger Aufwand bei der Antragstellung. Für 15 Prozent der KMU ist das ein Grund, es gar nicht erst zu versuchen. Vor allem kleinere Unternehmen scheuen diesen Weg.
Alternativen zu traditionellen Finanzierungsmodellen erleben einen Aufschwung
Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entscheiden sich für flexible, kleinere Lösungen anstelle des klassischen Bankkredits. Factoring, zum Beispiel: Rechnungen werden verkauft und sofort fließt Geld rein. Keine langfristige Verpflichtung, kein großer Kredit, sondern nur kurzfristige Liquidität, wenn sie benötigt wird.
Crowdfunding arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip. Anstatt einen großen Geldgeber oder eine Bank zu überzeugen, sammeln Unternehmen viele kleine Beträge von zahlreichen Personen. Es verteilt das Risiko und fördert gleichzeitig die Kundenbindung.
Auch Mini-Kredite ab 1.000 Euro erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Sie sind schnell zur Hand, einfach zu nutzen und bieten die Möglichkeit, mit kleinen Investitionen zu testen, bevor man größere Schritte wagt.
Das Prinzip der niedrigen Schwelle
In zahlreichen Branchen hat das „Niedrigschwellen-Prinzip“ seine Wirksamkeit bewiesen: Anstatt große Verpflichtungen zu verlangen, erlauben moderne Angebote einen Einstieg mit minimalem Risiko. Ein Beispiel aus einer anderen Branche sind Casinos mit 1€ Einzahlung – sie bieten Nutzern die Möglichkeit, Plattformen zu erkunden, Funktionen auszuprobieren und Vertrauen aufzubauen, bevor sie größere Beträge setzen.
Man kann dieses Konzept auf die Finanzierung von KMU anwenden: Warum nicht kleine, flexible Kreditbeträge nutzen, um Anbieter zu testen und Vertrauen aufzubauen? Faktoring mit niedrigen Mindestbeträgen, Crowdfunding-Kampagnen mit gestaffelten Zielen oder Mini-Kredite ab 1.000 Euro basieren genau auf dieser Logik. Sie reduzieren die psychologische Hürde, bieten Flexibilität und erlauben es Unternehmern, schrittweise die passende Finanzierungsform zu finden – ohne langfristige Verpflichtungen oder hohe Risiken einzugehen.
Die Vorteile der Kleinstformate
Ein entscheidender Vorteil von kleinen Beträgen ist, dass sie zur Disziplin zwingen. Wer 5.000 Euro statt 50.000 aufnimmt, plant sorgfältiger, wofür er das Geld nutzt. Das Risiko ist gering, die Rückzahlung ist machbar.
Zudem sind kleine Finanzierungen besser an die Gegebenheiten der modernen Geschäftswelt angepasst. Unternehmen hatten früher einen Investitionszeitraum von mehreren Jahren im Voraus. Heutzutage ist alles schneller, flexibler und unsicherer. Es ist sinnvoller, kurzfristig Liquidität zu holen, anstatt sich langfristig zu verschulden.
Die KfW-Studie belegt ebenfalls: Eine Vielzahl von Unternehmern erreicht ein höheres Alter. Mehr als 50 % der mittelständischen Unternehmer sind inzwischen über 55 Jahre alt. In der Nähe des Rentenalters oder der Übergabe möchte man keine großen Kredite mehr aufnehmen. Kleine, anpassungsfähige Lösungen sind da geeigneter.
Die Rückseite
Selbstverständlich bringt die Kredit-Abstinenz auch Nachteile mit sich. Um große Transformationsprojekte – wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle – erfolgreich umzusetzen, sind oft höhere Investitionen nötig, als man mit Eigenmitteln stemmen kann. Wer grundsätzlich auf Fremdkapital verzichtet, könnte wertvolle Investitionschancen verpassen.
Die KfW gibt zu bedenken: Unternehmen, die aus Prinzip keine Kredite aufnehmen, könnten langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden. In Zeiten grundlegender wirtschaftlicher Veränderungen sind manchmal größere finanzielle Schritte erforderlich.